Kultur- & Freizeit-Highlights unter der Lupe
Aktuelles
Highlights
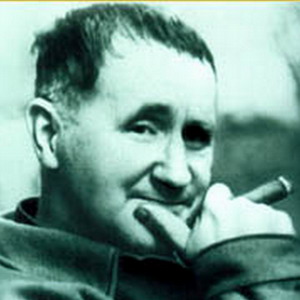
2.08.2006
Wer war eigentlich Bertholt Brecht?
...Experten antworten
Vorab zwei Leseproben:
Herr Keuner und die Zeichnung seiner Nichte
Herr Keuner sah sich die Zeichnung seiner kleinen Nichte an. Sie stellte ein Huhn dar, das über einen Hof flog. „Warum hat dein Huhn eigentlich drei Beine?“ fragte Herr Keuner. „Hühner können doch nicht fliegen“, sagte die kleine Künstlerin, „und darum brauchte ich ein drittes Bein zum Abstoßen.“
„Ich bin froh, dass ich gefragt habe“, sagte Herr Keuner
Das Wiedersehen
Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: „Sie haben sich gar nicht verändert.“ „Oh!“ sagte Herr K. und erbleichte.
Expertendienst der Freien Universität Berlin
Folgende Wissenschaftler stehen Ihnen für Interviews honorarfrei zur Verfügung:
Prof. Dr. Irmela von der Lühe
Freie Universität Berlin
Institut für Deutsche u. Niederländische Philologie
Abt. Neuere deutsche Literatur
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
Telefon: 030 / 838-55656
Telefon Sekr.: 030 / 838-54419
E-Mail: vdluehe@germanistik.fu-berlin.de
Schwerpunkte:
- Literatur und Theater Brechts in der Weimarer Republik und im Exil
- Politische und ästhetische Positionen und Konfrontationen z.B. mit Thomas Mann
- Freundschaften und Konstellationen: Walter Benjamin, Hannah Arendt
Prof. Dr. Rolf-Peter Janz
Freie Universität Berlin
Institut für Deutsche u. Niederländische Philologie
Abt. Neuere deutsche Literatur
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
Telefon: 030 / 838-54410
Telefon Sekr.: 030 / 838-55008
Telefon priv.: 030 / 324 31 22
E-Mail: rpjanz@zedat.fu-berlin.de
Schwerpunkte:
- Dramen
- Theoretische Schriften (Theaterkonzepte)
Dr. Gregor Streim
Freie Universität Berlin
Institut für Deutsche u. Niederländische Philologie
Abt. Neuere deutsche Literatur
Habelschwerdter Allee 45, 14195 Berlin
Telefon: 030 / 838-54431
Telefon Sekr.: 030 / 838-55403
E-Mail: streim@germanistik.fu-berlin.de
Schwerpunkt:
- Brechts Dramen
Dr. Toralf Teuber
Freie Universität Berlin
Institut für Publizistik u. Kommunikationswiss.
Arbeitsbereich Historische Publizistik
Malteserstr. 74-100, 12249 Berlin
Telefon: 030 / 838-70380
Telefon Sekr.: 030 / 838-70803
Telefon priv.: 030 / 34 78 16 18
E-Mail: toralf_teuber@yahoo.de
Schwerpunkte:
- Briefe an Bertolt Brecht im Exil 1933-1948
- Politische Verhältnisse im Exil
Dr. Hans-Friedrich Bormann
Freie Universität Berlin
Institut für Theaterwissenschaft
Grunewaldstr. 35, 12165 Berlin
Telefon: 030 / 838-50364
E-Mail: hfb@zedat.fu-berlin.de
Schwerpunkte:
- Brecht der 1920er Jahre
- Verhältnis von Politik und Theater
- Aktualität Brechts für das Theater der Gegenwart
- Verhältnis von Theater und technischen Medien
- Brecht, Müller, Handke
Weitere Experten im Internet unter: http://www.fu-berlin.de/presse/expertendienst
Telefonische Expertenvermittlung an der Freien Universität Berlin: 030 / 838-73180
Kommunikations- und Informationsstelle der
Freien Universität Berlin
Kaiserswerther Str. 16-18
14195 Berlin
Tel.: 030 / 838-73182
Fax: 030 / 838-73187
E-Mail: pdw@zedat.fu-berlin.de
Biograhie:
Eugen Berthold Friedrich Brecht kam am 10. Februar 1898 in Augsburg auf die Welt. Sein Vater war Berthold Friedrich Brecht, Direktor der Haindlschen Papierfabrik, seine Mutter Sofie Brecht (geborene Brezing). Der junge Brecht wurde Eugen genannt (Berthold bzw. Bertolt wählte er als Rufnamen erst später). Er war ein eher schüchterner, immer etwas kränkelnder Junge, der stets liebevoll von seiner Mutter umsorgt wurde. Er besuchte nach der Volksschule von 1908 bis 1917 das heute noch bestehende Peutinger-Realgymnasium in Augsburg, welches er mit dem Notabitur abschloss.
Anfänglich noch von der allgemeinen Kriegseuphorie angesteckt, kritisierte er schon in seiner Schulzeit in einem Aufsatz über Horaz Dulce et decorum est ... deutlich den Krieg („Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben“; eine „Zweckpropaganda“, auf die nur „Hohlköpfe“ hereinfallen), wofür er mit einem von seinen ersten Schulverweisen bestraft wurde. Nur die angesehene Stellung seines Vaters und die Intervention eines Religionslehrers, der sich für ihn einsetzte, bewahrte ihn vor der Vollstreckung dieser Strafe.
Schaffenszeit vor dem Exil:
1920 starb Brechts Mutter. Im gleichen Jahr schloss er Freundschaft mit dem bekannten Kabarettisten Karl Valentin, den er sehr schätzte. Die gemeinsame Arbeit hat das spätere Schaffen Brechts deutlich beeinflusst. Ab 1920 reiste Brecht oft nach Berlin, um Beziehungen zu Personen aus dem Theater und zur literarischen Szene aufzubauen. 1924 zog er ganz nach Berlin. Hier arbeitete er zunächst zusammen mit Carl Zuckmayer als Dramaturg an Max Reinhardts Deutschem Theater, an den Münchner Kammerspielen inszenierte er in diesen Jahren selbst. Im Jahr 1922, dem Jahr als er den Kleist-Preis verliehen bekam, heiratete er die Schauspielerin und Opernsängerin Marianne Zoff. Ein Jahr später bekamen sie am 12. März eine Tochter mit Namen Hanne (Hiob).
Kurz danach lernte er seine spätere Frau Helene Weigel kennen, die 1924 seinen zweiten Sohn Stefan gebar. Drei Jahre später ließ er sich von Marianne Zoff scheiden. Nach der Heirat mit Helene Weigel 1929 kam Tochter Barbara zur Welt.
Brecht entwickelte sich in der zweiten Hälfte der 20er Jahre zum überzeugten Kommunisten und verfolgte fortan mit seinem Werk politische Ziele. Er trat aber nie in die KPD ein. Parallel zur Entwicklung des politischen Denkens verläuft ab 1926 die Entwicklung des epischen Theaters. Ein wichtiger theatertheoretischer Aufsatz sind die Anmerkungen zur Oper Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930, zusammen mit Peter Suhrkamp verfasst). Die Zusammenarbeit mit Kurt Weill in mehreren musikdramatischen Werken war für die Entwicklung des epischen Theaters wesentlich.
Mit seinen Werken wollte Brecht gesellschaftliche Strukturen durchschaubar machen, vor allem in Hinsicht auf ihre Veränderbarkeit. Literarische Texte mussten für ihn einen Gebrauchswert, einen Nutzen haben.
Die Marxismusrezeption Brechts wurde dabei sowohl von undogmatischen und parteilosen Marxisten wie Karl Korsch, Fritz Sternberg und Ernst Bloch als auch von der offiziellen KPD-Linie beeinflusst. Es entstand eine Reihe marxistischer Lehrstücke. Die Werke aus dieser Zeit sind beeinflusst durch das Studium der Schriften von Hegel und Marx. Die 1927 veröffentlichte Gedichtsammlung Bertolt Brechts Hauspostille besteht jedoch weitestgehend aus früher verfassten Texten. 1928 feierte Brecht mit seiner von Kurt Weill vertonten Dreigroschenoper einen der größten Theatererfolge der Weimarer Republik. Eine verbreitete Vorstellung sieht im Welterfolg ein Missverständnis: Geschrieben als Gesellschaftskritik, umjubelt von jenen, die Brecht kritisieren wollte. Von anderen Forschern werden die unscharfen Konturen der Gesellschaftskritik insbesondere in der Fassung von 1928 hervorgehoben und die These eines Missverständnisses abgewiesen. In späteren Überarbeitungen, vor allem in seinem von den Produzenten abgelehnten Drehbuch für die Verfilmung der Dreigroschenoper und in seinem "Dreigroschenroman" (1934), verschärfte Brecht die kritische Tendenz des Stoffes erheblich.
Brecht wollte immer mit seinen Auftritten Einfluss nehmen, suchte sich gezielt Medien wie z. B. das Radio oder das Theater aus, mit denen er das entsprechende Publikum erreichen konnte. Er strebte eine allmähliche gesellschaftliche Umwälzung an, in der es zur Inbesitznahme der Produktionsmittel durch die Arbeiterklasse kommen sollte.
Leben im Exil [Bearbeiten]
Zu Beginn des Jahres 1933 wurde eine Aufführung von Die Maßnahme durch die Polizei unterbrochen. Die Veranstalter wurden wegen Hochverrats angeklagt. Am 28. Februar – einen Tag nach dem Reichstagsbrand – verließ Brecht mit seiner Familie und Freunden Berlin und flüchtete über Prag, Wien und Zürich schließlich nach Skovsbostrand bei Svendborg auf Fünen in Dänemark, wo er sich die nächsten fünf Jahre aufhielt. Im Mai des Jahres wurden seine Werke von den Nationalsozialisten verbrannt.
Brechts Zeit im Exil war sicherlich die härteste Zeit seines Lebens, obwohl er in diesen Jahren einige seiner größten Werke verfasste. 1938 entstand Das Leben des Galilei. Das Stück handelt vom Leben des großen Naturwissenschaftlers, der angesichts der Folterinstrumente der Heiligen Inquisition seine Lehre von der Bewegung der Erde widerrief. Außer Dramen schrieb er auch Beiträge für mehrere Emigrantenzeitschriften in Prag, Paris und Amsterdam. Im Jahre 1939 verließ Brecht Dänemark, lebte ein Jahr in einem Bauernhaus in der Nähe Stockholms und im April 1940 in Helsinki. Brecht im Exil äußerte sich nie explizit kritisch gegenüber Obrigkeit, Staat und Gesellschaft, sondern immer nur unterschwellig; gerade so kritisch, dass er sich nicht selbst zum Märtyrer seiner Ideen machte. Während eines Sommeraufenthalts in Marlebäck, wohin die Familie von der finnischen Schriftstellerin Hella Wuolijoki eingeladen worden war, schrieb Brecht nach einem Text Wuolijokis den Puntila. Im Sommer 1941 fuhr er via Moskau im Transsibirienexpress nach Wladiwostok. Vom Osten der UdSSR fuhr er mit dem Schiff nach Kalifornien, wo er in Santa Monica in der Nähe von Hollywood lebte. Er stellte sich vor, als Drehbuchautor eine Rolle im Filmgeschäft zu spielen. Dazu kam es nicht. Er hatte kaum Möglichkeit zur politischen Arbeit und bezeichnete sich selbst angesichts des Desinteresses der US-Amerikaner als „Lehrer ohne Schüler“. Mit Charles Laughton, der später in Brechts einziger Theaterarbeit im amerikanischen Exil die Hauptrolle spielte, übersetzte er sein Stück Leben des Galilei, dessen ursprüngliche Fassung am 9. September 1943 im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wurde.
Die USA unterstellten ihm eine kommunistische Einstellung, weshalb er am 30. Oktober 1947 vom Komitee für unamerikanische Aktivitäten vorgeladen und verhört wurde. Auf die Frage, ob Brecht jemals Mitglied der Kommunistischen Partei war oder noch ist, entgegnete Brecht mit dem Hinweis, dass er diese Frage für nicht gerechtfertigt erachte, er aber trotzdem mit dem Verlesen eines vorbereiteten Statements dazu Stellung beziehen möchte. Dies wurde nicht erlaubt und so stellte Brecht fest, dass er nicht Mitglied der oder einer KP war oder ist, auch nicht der Deutschen Kommunistischen Partei. Einen Tag später reiste er – während der Premiere von Das Leben des Galilei in New York – über Paris nach Zürich. Dort hielt er sich ein Jahr auf, da die Schweiz das einzige Land war, in das er noch einreisen durfte; die Einreise nach West-Deutschland wurde ihm untersagt. Im Februar 1948 wurde "Die Antigone des Sophokles" im Stadttheater Chur uraufgeführt. Drei Jahre später erlangte er die österreichische Staatsbürgerschaft.
Rückkehr nach Berlin:
Am 22.10.1948 kehrte er mit tschechoslowakischem Pass über Prag nach Ost-Berlin zurück. Er wohnte, bis er in seinem späteren Brecht-Haus in Berlin-Weißensee einziehen konnte, im notdürftig instandgesetzten Hotel Adlon. Später wohnte er in der Chausseestraße in Berlin direkt neben dem Dorotheenstädtischen Friedhof, auf dem er nach seinem Tod bestattet wurde. Hier führte er ein relativ gut situiertes Leben. Im Haus in der Chausseestraße wurde noch vor 1989 eine Gedenkstätte eingerichtet. Im Herbst 1949 gründete er mit Helene Weigel das Berliner Ensemble. Anschließend arbeitete er wieder engagiert für das Theater und erreichte sogar einige Gastspiele in europäischen Großstädten. Nicht nur deshalb kam es bald zu Spannungen mit Vertretern der DDR-Kulturbürokratie. Es wurden auch diverse Stücke abgelehnt, wie z. B. Die Heilige Johanna der Schlachthöfe und der Film Kuhle Wampe. Als es am 17. Juni 1953 zu Massenprotesten der Arbeiter in der DDR kam, äußerte er noch am selben Tag in einem Brief an Walter Ulbricht Zustimmung zu den Maßnahmen der DDR-Regierung und zum Eingreifen der sowjetischen Truppen. In der poetischen Reflexion der Ereignisse zeigte sich allerdings eine deutlich distanziertere Haltung, die sich in dem Gedicht Die Lösung artikulierte. Eine Haltung, die er später – weil er sich vom Westen instrumentalisiert sah – wieder korrigierte.
In seinen letzten Lebensjahren widmete sich Brecht als Leiter des Berliner Ensembles intensiv der Förderung schriftstellerischer wie theatralischer Talente. Es war dabei sein grundsätzliches Bestreben, alle, die er für begabt hielt, in die praktische Theaterarbeit einzubinden, was ihm freilich bei den Schriftstellern nur selten gelang. Zu den jungen Leuten in seinem Umfeld gehören berühmte Namen, von denen man jedoch nicht jeden unbedingt als „Brecht-Schüler“ bezeichnen kann: Heinz Kahlau, Slatan Dudow, Erwin Geschonneck, Erwin Strittmatter, Peter Hacks, Benno Besson, Peter Palitzsch, Ekkehard Schall, Heinz Schubert.
Friedrich Torberg setzte zusammen mit Hans Weigel in Österreich einen Boykott gegen die Aufführung der Werke von Bertolt Brecht an den österreichischen Bühnen durch, der bis 1962 anhielt. In der Bundesrepublik Deutschland hingegen dürfen alle Werke von Brecht bis heute ungehindert verbreitet werden. 1955 erhält Brecht den Internationalen Stalin-Friedenspreis, den er persönlich in Moskau entgegennimmt.
Tod:
Im Mai des Jahres 1956 wurde Brecht mit einer Grippe in das Berliner Charité-Krankenhaus eingeliefert. Er starb am 14. August 1956 in Berlin an einem Herzinfarkt. Zusammen mit seiner 1971 verstorbenen Frau Helene Weigel liegt er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof begraben.
